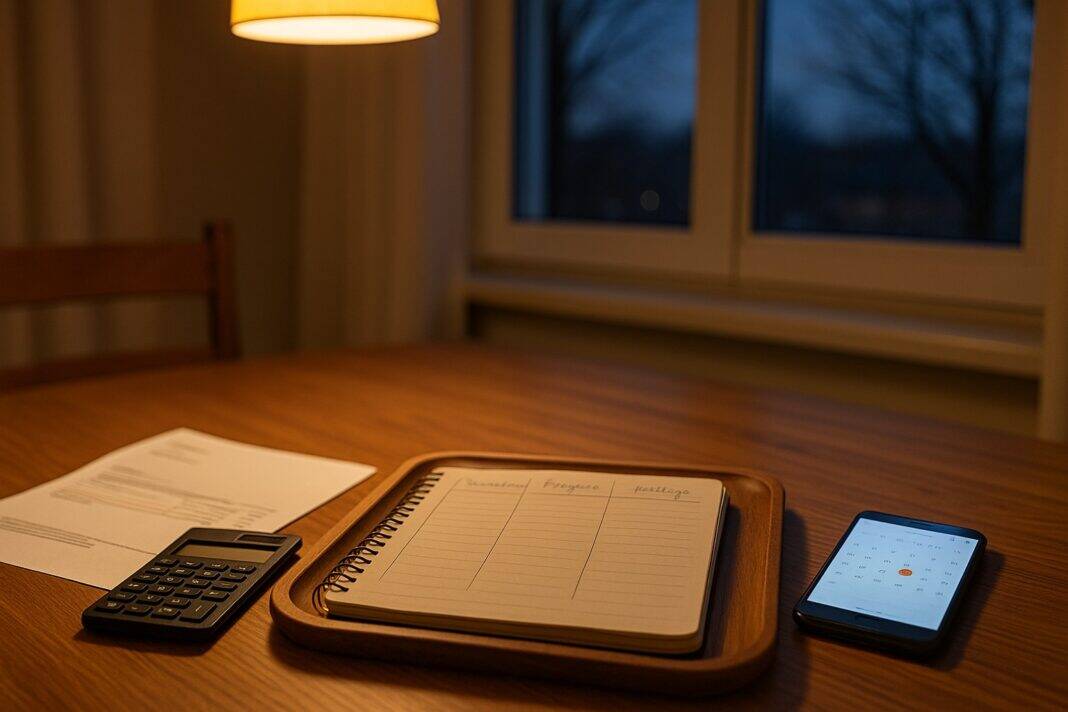Die Heizkurve ist das Gehirn Ihrer witterungsgeführten Heizung. Sie bestimmt, wie warm das Heizwasser (Vorlauftemperatur) sein soll, wenn es draußen kälter oder milder wird. Ist die Kurve zu hoch, verbraucht die Anlage unnötig Energie, taktet unruhig und überheizt Räume. Ist sie zu niedrig, bleiben Zimmer an kalten Tagen unter Wohlfühl‑Niveau. Die gute Nachricht: Mit einem strukturierten Vorgehen lässt sich die Heizkurve in wenigen Tagen so einstellen, dass Sie gleichmäßig warme Räume bei minimaler Vorlauftemperatur erreichen – in Altbau wie Neubau, mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung, mit Brennwertkessel oder Wärmepumpe.
Dieser Praxis‑Guide erklärt in klarer Sprache, was eine Heizkurve ist, wie Steigung und Parallelverschiebung funktionieren, wie Sie Unterschiede zwischen Altbau und Neubau berücksichtigen und warum Einzelraumregelungen (ERR) und Lüftungsgewohnheiten Ihre Ergebnisse beeinflussen. Außerdem erhalten Sie konkrete Startwerte, einen 7‑Tage‑Einstellplan für Radiatoren und Fußbodenheizungen, Checks zur Fehlerdiagnose und Tipps für typische Sonderfälle (Dachgeschoss, Nordfassade, große Fenster). Alles ist auf deutschsprachige Haushalte ausgelegt – praxistauglich, ohne Fachsimpelei und mit Blick auf aktuelle Markttrends (smarte Regler, günstige Sensor‑Bundles im Herbst, Effizienzvorteile niedriger Vorläufe bei Brennwert und Wärmepumpe).
Heizkurve in 3 Minuten verstanden
Die Heizkurve – oft auch Heizkennlinie genannt – setzt die Außentemperatur in eine Vorlauftemperatur um. Je kälter es draußen ist, desto wärmer muss das Heizwasser sein, damit die Räume die Zieltemperatur halten. Zwei Stellgrößen sind entscheidend: die Steigung (wie stark die Vorlauftemperatur je Grad Außentemperatur fällt oder steigt) und die Parallelverschiebung oder Niveau (eine Art Grundoffset nach oben oder unten). Manche Regler kennen zusätzlich einen Fußpunkt (Min‑Vorlauf) und einen Endpunkt (Max‑Vorlauf).
In der Praxis heißt das: Ist es draußen +10 °C, könnte die Anlage z. B. 32 °C Vorlauf fahren, bei 0 °C vielleicht 40 °C und bei −10 °C 50 °C – je nach Gebäude und System. Eine flachere Steigung liefert niedrigere Vorläufe und spart Energie, solange die Räume warm bleiben. Eine höhere Steigung ist nötig, wenn besonders kalte Tage die Räume sonst unterheizen. Mit der Parallelverschiebung korrigieren Sie die Komfortlage bei milder Witterung: Ist es bei +10 °C zu warm, senken Sie das Niveau; ist es zu kühl, heben Sie es an.
Warum richtige Kurven so viel sparen
Niedrigere Vorlauftemperaturen reduzieren Wärmeverluste in Leitungen und an Heizflächen. Brennwertkessel kondensieren besser, wenn die Rücklauftemperatur niedrig ist – das steigert den Wirkungsgrad. Wärmepumpen erreichen ihren besten COP bei niedrigen Vorläufen; jeder Grad weniger spart Strom. Zusätzlich läuft die Anlage ruhiger: weniger Takten, weniger Strömungsgeräusche, längere Lebensdauer. All das entsteht nicht durch Frieren, sondern durch passendes Matching von Gebäude, Heizflächen und Regelung.
Altbau vs. Neubau: Was macht den Unterschied?
Altbauten besitzen oft kleinere Heizflächen (Kompaktradiatoren), weniger Dämmung und mehr Zugluft. Sie benötigen bei gleichem Außenklima eher höhere Vorlauftemperaturen und reagieren schneller auf Wind und Lüftung. Neubauten mit guter Hülle, Dreifachverglasung und Fußbodenheizung kommen mit flachen Kurven und niedrigen Vorläufen aus; sie sind träger, aber äußerst effizient, wenn die Kurve stimmt.
Der praktische Schluss: Altbau = etwas steilere Steigung, dafür behutsame Parallelverschiebung; Neubau/FBH = sehr flache Steigung, feine Anpassungen am Niveau und geduldige Beobachtung, weil die Bauteilträgheit hoch ist. In Mischsystemen (FBH im EG, Radiatoren im OG) muss die Regelung die kritischste Zone sauber bedienen – oft hilft eine Vorlaufmischung oder ein zusätzliches Heizkreis‑Modul.
Was darf ich einstellen – und was nicht?
In Eigentum (Einfamilienhaus, Wohnung mit eigener Therme/Wärmepumpe) dürfen Sie die Reglerparameter Ihrer Anlage in der Regel selbst anpassen – immer schriftliche Herstellerhinweise beachten. In Mietwohnungen übernimmt die Hausverwaltung die Anlagenseite. Sie regeln im Raum (Thermostatköpfe, Zeitprogramme) und melden Auffälligkeiten. Unser Guide richtet sich an alle – die Einstellschritte gelten systemisch, die Zugriffsrechte unterscheiden sich.
Voraussetzungen für erfolgreiches Feintuning
Bevor Sie starten, sorgen Sie für freie Heizflächen (keine Sofa‑Rücken direkt vor Radiatoren, keine bodenlangen Vorhänge über Heizkörpern), korrekt entlüftete Heizkörper, funktionierende Umwälzpumpe und – soweit vorhanden – offene Thermostatventile in den Referenzräumen (mindestens Stufe 3). Nur dann zeigt die Heizkurve, was sie kann. Bei Fußbodenheizung müssen alle Heizkreise offen und Durchflussanzeiger plausibel sein; sonst verpuffen die Effekte.
Grundbegriffe, die Sie einmal lesen sollten
Steigung: Gibt an, wie stark sich die Vorlauftemperatur mit der Außentemperatur ändert. Hohe Steigung = hoher Vorlauf bei Kälte; niedrige Steigung = flacher Anstieg.
Parallelverschiebung/Niveau: Verschiebt die gesamte Kurve nach oben/unten, ohne die Steigung zu ändern. Nützlich, wenn es bei milder Witterung insgesamt zu warm/kalt ist.
Heizpause/Heizgrenze: Außentemperatur, ab der die Heizung automatisch abschaltet (z. B. +16 °C). Zu hoch eingestellt → unnötiges Heizen an milden Tagen.
Raumeinfluss/Raumaufschaltung: Einige Regler berücksichtigen einen Innenfühler. Das kann helfen, führt aber bei starker Sonneneinstrahlung oder Kaminbetrieb zu Fehlinterpretationen. Für’s Einstellen eher niedrig wählen.
Nachtabsenkung: Zeitliche Reduzierung der Solltemperatur. Bei Wärmepumpe/FBH nur mild einsetzen (1–2 K), bei Radiatoren 2–3 K. Eine zu starke Absenkung konterkariert flache Kurven.
Startwerte: realistische Baselines für verschiedene Systeme
Es gibt keine „magische“ Kurve, aber erprobte Startpunkte:
- Altbau mit Radiatoren (Brennwertkessel): Steigung 1,2–1,6, Niveau 0 bis +2 K; Max‑Vorlauf zunächst 55–60 °C, später absenken, wenn alle Räume warm werden.
- Neubau mit Radiatoren: Steigung 0,8–1,2, Niveau 0 K; Max‑Vorlauf oft 45–55 °C ausreichend.
- Fußbodenheizung (Neubau/modernisierte Hülle): Steigung 0,3–0,6, Niveau 0 K; Min‑Vorlauf 28–32 °C, Max 35–40 °C (je nach Bodenaufbau).
- Wärmepumpe: Tendenziell flach (wie oben), Max‑Vorlauf so niedrig wie möglich (komfortgetrieben), Heizgrenze nicht zu hoch (sonst unnötiges Takten bei mildem Wetter).
Diese Spannen sind Startpunkte. Das eigentliche Sparen beginnt mit Beobachten und Nachregeln.
Der 7‑Tage‑Plan: So stellen Sie die Heizkurve systematisch ein
Der sichere Weg führt über kleine Schritte und gezielte Messpunkte. Planen Sie eine Woche ein, ideal in der Übergangszeit oder zu Beginn der Heizperiode.
Tag 1–2: Kurve flach beginnen, Referenzraum wählen
Wählen Sie einen Referenzraum (Wohnzimmer/Arbeitszimmer), der repräsentativ ist und keine Zusatzwärmen hat (Kamin, große Südfenster am Mittag). Stellen Sie Thermostat dort auf Stufe 3–3,5 (≈ 20–21 °C) und öffnen Sie die Heizfläche. Senken Sie die Steigung auf den empfohlenen Startwert (z. B. Altbau Radiatoren 1,2; Neubau FBH 0,4). Parallelverschiebung auf 0 K. Lassen Sie die Anlage 24 Stunden laufen. Protokollieren Sie: Außentemperatur‑Spanne, Vorlauf, Rücklauf, Raumtemperatur morgens/abends.
Bleibt der Referenzraum zu warm, reduzieren Sie Niveau um –1 K. Bleibt er zu kühl, erhöhen Sie Niveau um +1 K. Die Steigung fassen Sie an Tag 1–2 nicht an – erst, wenn kalte Tage kommen.
Tag 3–4: Steigung prüfen – was passiert, wenn’s kälter wird?
Fällt die Außentemperatur, beobachten Sie: Erreicht der Raum die Ziele auch bei kühlerem Wetter? Wenn ja, bleibt die Steigung. Wenn nein (der Raum fällt deutlich ab), erhöhen Sie die Steigung um +0,1 bis +0,2. Wird es bei milderem Wetter überall zu warm, war die Steigung zu hoch: –0,1 bis –0,2. Parallelverschiebung bleibt unverändert, bis die Steigung passt.
Tag 5–6: Feintuning Niveau & Heizgrenze
Sitzt die Steigung, bringen Sie die Komfortlage mit der Parallelverschiebung in die Spur. Ziel: Bei milder Witterung keine Übertemperaturen, bei kühler Witterung kein Frieren. Prüfen Sie zusätzlich die Heizgrenze (z. B. +16 °C): Schaltet die Heizung bei sonnig‑milden Tagen sichtbar zu früh ein, senken Sie die Heizgrenze um 1–2 K. Umgekehrt nicht zu tief – sonst bleibt es an kühlen Morgenstunden unnötig kalt.
Tag 7: Rücklauftemperatur, Taktung und Geräusch prüfen
Kontrollieren Sie, ob die Rücklauftemperatur niedriger ist als früher (Brennwertnutzen!), ob die Anlage seltener taktet und die Heizflächen gleichmäßig warm werden. Die Räume sollten ohne häufiges Eingreifen der Thermostatköpfe stabil bleiben. Erst jetzt lohnt es, den Max‑Vorlauf um weitere 2–5 K zu senken – solange Komfort gehalten wird.
Besonderheiten und Stolpersteine – so umgehen Sie sie souverän
Viele Regelprobleme haben einfache Ursachen: verdeckte Heizkörper, klemmende Thermostatventile, Luft im System, falsche Fühlerpositionen oder fehlender hydraulischer Abgleich. Beheben Sie diese Punkte, bevor Sie der Heizkurve die Schuld geben.
Außentemperaturfühler: Standort zählt
Der Fühler gehört an eine schattige Nord‑/Nordwestseite, gut belüftet, nicht über Fenster, nicht über Abluftöffnungen, nicht an sonnengedämpften Balkonwänden. Falsche Montage führt zu Messfehlern: Zu warme Anzeige → Anlage fährt zu „flach“, Räume kühlen aus; zu kalte Anzeige → Anlage überheizt. Wenn Sie im Eigentum merken, dass der Fühler störend positioniert ist, lohnt die Korrektur.
Raumaufschaltung: Hilfe oder Störgröße?
Innenfühler können helfen, solare Gewinne zu berücksichtigen. In der Einstellphase stören sie oft, weil sie Fremdwärme (Backofen, Gäste, Kamin) zu stark gewichten. Stellen Sie den Raumeinfluss für die Justage niedrig (oder aus), bis die Heizkurve sitzt. Danach können Sie ihn wieder moderat aktivieren.
Altbau mit Radiatoren: Schritt‑für‑Schritt‑Vorgehen
Altbauten sind variabel – von gut modernisiert bis unsaniert. Gemeinsam ist: größere Schwankungen durch Wind, Kältebrücken und Fensterqualität. So gehen Sie vor:
Startwerte setzen und Referenzräume wählen
Wählen Sie zwei Referenzräume: Wohnzimmer (Komfort) und kältester Raum (oft Schlafzimmer oder Nordseite). Stellen Sie Thermostate dort offen (3–3,5). Starten Sie mit Steigung 1,3 und Niveau 0 K. Max‑Vorlauf zunächst 55–60 °C. Heizen Sie 24 Stunden und prüfen Sie, ob beide Räume nah an 20 °C bleiben.
Sind die Warmzonen zu warm, senken Sie Niveau schrittweise; ist der kalte Raum zu kühl, erhöhen Sie zunächst Steigung (nicht das Niveau), denn Kälteproblem = meist Steigungsproblem. Wenn es bei milder Witterung zu warm ist, bei Kälte aber passt, ist die Steigung zu steil – reduzieren und das Niveau leicht anheben.
Feuchte & Lüften mitdenken
Altbauten reagieren auf Feuchte stark. Halten Sie 40–60 % rF, lüften Sie ereignisbezogen (Dusche, Kochen) und schließen Sie Türen zu kühlen Räumen. Rollläden abends runter – besonders an Einfach‑ oder älteren Doppelverglasungen – reduziert Verluste an der Fensterfläche.
Neubau mit Fußbodenheizung: Geduld zahlt sich aus
FBH‑Systeme sind träge. Einmal korrekt eingestellt, liefern sie gleichmäßige Behaglichkeit bei sehr niedrigen Vorläufen – ideal für Wärmepumpen.
So finden Sie die richtige flache Kurve
Starten Sie mit Steigung 0,4 und Niveau 0 K. Setzen Sie Min‑Vorlauf auf 30 °C, Max auf 35–38 °C (je nach Bodenbelag). Halten Sie die Einzelraum‑Stellmotoren zunächst offen (oder Voreinstellung Mittelwert), damit der Regler die Hülle „sieht“. Warten Sie 48 Stunden, bevor Sie bewerten – die träge Masse braucht Zeit.
Fühlen sich Räume zu warm an, senken Sie Niveau um 1 K. Sind nur kalte Tage problematisch, erhöhen Sie Steigung +0,1. Vermeiden Sie große Nachtabsenkungen; die FBH braucht sonst morgens lange, um wieder hochzukommen. Eine milde Absenkung von 1–2 K ist meist genug.
Möblierung und Bodenbeläge beachten
Dicke Teppiche, große Möbel ohne Füße und Matratzen am Boden wirken wie Dämmung. Setzen Sie auf luftige Möblierung und lassen Sie Luftwege frei. Prüfen Sie die Durchflüsse am Heizkreisverteiler: Räume mit langen Schleifen benötigen ggf. mehr Durchfluss, kurze Schleifen weniger – das ist kein „Hexenwerk“, aber gehört in fachkundige Hände, wenn Sie unsicher sind.
Mischsysteme & Sonderfälle: Wenn nicht alles gleich ist
Viele Häuser haben FBH im Erdgeschoss und Radiatoren im Obergeschoss. Der Radiatorkreis braucht meist höhere Vorläufe. Lösung: gemischter Heizkreis für die FBH mit eigenem Regler. Ist nur ein Regler vorhanden, nivellieren Sie auf den kritischsten Raum und nutzen Sie Einzelraumregelungen in den übrigen Räumen, um Überhitzung zu dämpfen.
Dachgeschoss, große Glasflächen, Nordlagen
Dachgeschosse verlieren nachts schneller Wärme; Nordräume haben weniger solare Gewinne. Es ist normal, dass hier die Steigung gefühlt „nicht überall passt“. Arbeiten Sie mit Tür‑Management (Türen zu!), Rollläden und kleinen Niveau‑Anhebungen – nicht mit extremen Steigungen, die das gesamte Haus überheizen würden. Große Südfenster liefern tags viel Wärme: Aktivieren Sie ggf. moderaten Raumeinfluss, damit der Regler bei Solarüberschuss absenkt.
Einzelraumregelungen (ERR) sinnvoll einsetzen
Thermostatköpfe und Raumregler sind Feintuning, nicht die Hauptregelung. Ziel ist, dass alle ERR möglichst offen bleiben können, weil die Heizkurve so gut passt, dass nur selten gedrosselt wird. Dauerhaft geschlossene Köpfe erzeugen hohe Rückläufe (schlecht für Brennwert/Wärmepumpe) und stören den Durchfluss. Stellen Sie deshalb nach Kurven‑Feintuning die Köpfe knapp auf Zieltemperatur – der Rest kommt von der Heizkurve.
Türenmanagement & Lüften – unterschätzte Hebel
Offene Türen „leeren“ Warmzonen; feuchte Luft aus Bad/Küche wandert in kühle Zimmer und kondensiert. Schließen Sie Türen, lüften Sie kurz & quer nach Ereignissen, und nutzen Sie Rollläden als kostengünstige „Nachtdämmung“. So müssen Sie weniger Vorlauf fahren, um denselben Komfort zu halten.
Monitoring: So merken Sie, dass die Kurve passt
Wenn die Heizkurve richtig eingestellt ist, erleben Sie drei Dinge: (1) Stabile Raumtemperaturen ohne ständiges Nachregeln, (2) niedrigere Vor‑ und Rückläufe bei gleichem Komfort, (3) ruhiger Anlagenbetrieb – weniger Takten, weniger Geräusche. Ein Hygro‑/Thermometer in den Hauptzonen und ein gelegentlicher Blick auf Vor‑/Rücklauf am Kessel/der Wärmepumpe reichen als Feedback.
Praktisch ist ein Mini‑Protokoll: Datum, Außentemperatur (Min/Max), Vorlauf/Rücklauf, Raumtemperatur morgens/abends, Komfortnote (1–5). Nach einer Woche sehen Sie Trends – und ob weitere 0,1‑Schritte an Steigung/Niveau sinnvoll sind.
Brennwertkessel & Wärmepumpe: Spezielle Hinweise
Brennwertkessel sparen besonders, wenn Rückläufe niedrig sind (unterhalb der Taupunkttemperatur der Abgase). Das gelingt mit flacher Kurve, offenen Heizflächen und moderaten Thermostatstellungen. Zu hohe Vorläufe verhindern Kondensation – verschenktes Potenzial.
Wärmepumpen lieben stabile, niedrige Vorläufe. Jedes zusätzliche Grad kostet spürbar Effizienz. Daher: Nachtabsenkungen nur mild, große Sprünge vermeiden, Heizgrenze nicht unnötig hoch. In gut gedämmten Häusern können Vorläufe im Dreißiger‑Bereich reichen – Komfort entscheidet.
Warmwasser, Zirkulation und Heizkurve – der Zusammenhang
Warmwasser und Heizbetrieb sind getrennte Welten, beeinflussen sich aber über die Gesamtlast. Eine dauerhaft laufende Zirkulationspumpe erhöht den Wärmebedarf und damit indirekt die Vorlaufanforderung. Schalten Sie Zeitfenster (morgens/abends) und lassen Sie die Pumpe sonst ruhen. So bleibt die Heizkurve „in Ruhe“ und muss keine unnötigen Spitzen abfangen.
Kostenwirkung & Markttrends 2025 kurz bewertet
Der wirtschaftliche Hebel der Heizkurve liegt darin, keine höhere Vorlauftemperatur zu fahren als nötig. Das senkt Energieverbrauch, Strombedarf der Wärmepumpe und reduziert Taktungen. Im Herbst bieten Händler regelmäßig smarte Thermostat‑Bundles und Sensor‑Kits (Temperatur/Feuchte) günstiger an – genau die Tools, die das Feintuning messbar machen. Für viele Haushalte rechnet sich die Stunde Kurven‑Feinarbeit schon in der ersten Heizperiode.
Checkliste „Vor dem Feintuning“ (kompakt)
• Heizflächen freistellen, entlüften, Referenzraum wählen, Hygrometer platzieren
• Thermostat im Referenzraum auf 3–3,5, übrige Räume normal; Zeitfenster notieren
Häufige Fehler – und die schnellen Gegenmaßnahmen
Zu steil eingestellt: Räume sind an milden Tagen zu warm, Thermostate drosseln stark, Rückläufe hoch → Steigung –0,1 bis –0,2, Niveau ggf. +1 K.
Zu flach eingestellt: Bei Kälte fallen Räume ab → Steigung +0,1 bis +0,2; erst wenn’s passt, Niveau feinjustieren.
Niveau statt Steigung geändert: Bei Kälte zu kühl → Steigung korrigieren, nicht nur Niveau.
Große Nachtabsenkung bei FBH/WP: Träge Hülle, morgens lange Anlaufzeit → Absenkung max. 1–2 K.
Thermostate fast zu: Hohe Rückläufe, Wärmeerzeuger taktet → Kurve besser einstellen, Thermostate weiter öffnen.
Außentemperaturfühler in der Sonne: Falsche Werte → Montage prüfen/versetzen lassen.
FAQ – kurz & praxisnah
Wie schnell sollte ich Änderungen merken? Bei Radiatoren oft binnen Stunden, bei FBH nach 24–48 Stunden. Geduld ist Teil des Plans.
Welche Raumtemperatur soll ich anpeilen? Häufig bewährt: Wohnräume 19–21 °C, Schlafzimmer 16–18 °C, Bad zeitweise 21–23 °C. Komfort entscheidet.
Muss ich gleichzeitig hydraulisch abgleichen? Ein Abgleich ist Gold wert, aber nicht zwingend für die ersten Schritte. Wenn einzelne Räume hinterherhinken, lohnt er sich.
Heizkurve oder Nachtabsenkung – was ist wichtiger? Die Kurve. Sie läuft 24/7. Nachtabsenkung ist Feintuning.
Kann ich im Mietshaus etwas tun, wenn ich die Kurve nicht einstellen darf? Ja: Thermostate moderat, Zeitfenster schlank, Türenmanagement, Rollläden, Stoßlüften. Auffälligkeiten an die Verwaltung melden.
Fazit: Die richtige Kurve macht jeden Tag günstiger
Eine gut eingestellte Heizkurve ist das größte kostenlose Effizienz‑Upgrade Ihrer Heizung. Sie sorgt für behagliche Räume, senkt Vorlauf/Rücklauf und damit Energie‑ und Stromkosten, und sie beruhigt die gesamte Anlage. Mit unseren Startwerten, dem 7‑Tage‑Plan und den Sonderfall‑Tipps finden Sie rasch die Linie, die zu Ihrem Gebäude, Ihren Heizflächen und Ihrem Alltag passt – im Altbau ebenso wie im Neubau.
Bleiben Sie pragmatisch: kleine Schritte, beobachten, notieren, feinjustieren. Sobald die Räume ohne viel Thermostat‑Action stabil sind, haben Sie Ihr Ziel erreicht. Und das Beste: Diese Einstellung trägt jede Heizsaison – mit minimalen Nachregeln, wenn das Wetter wechselt.